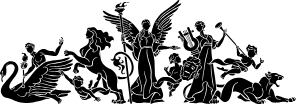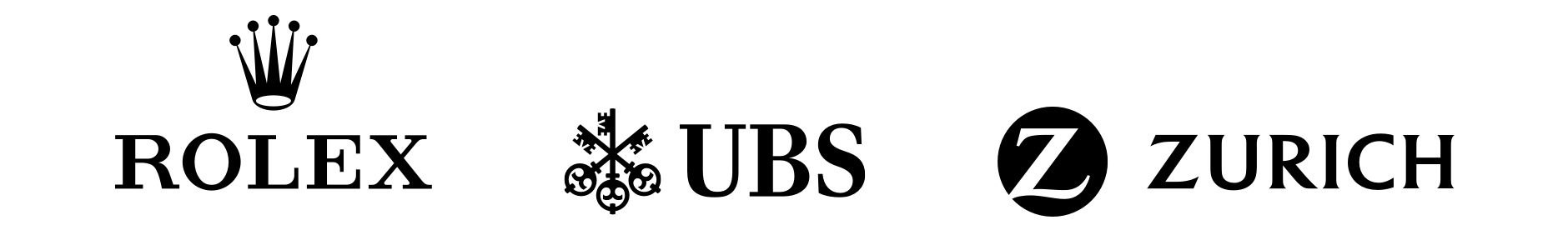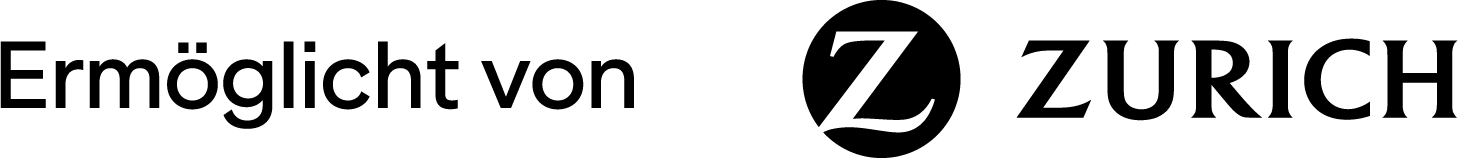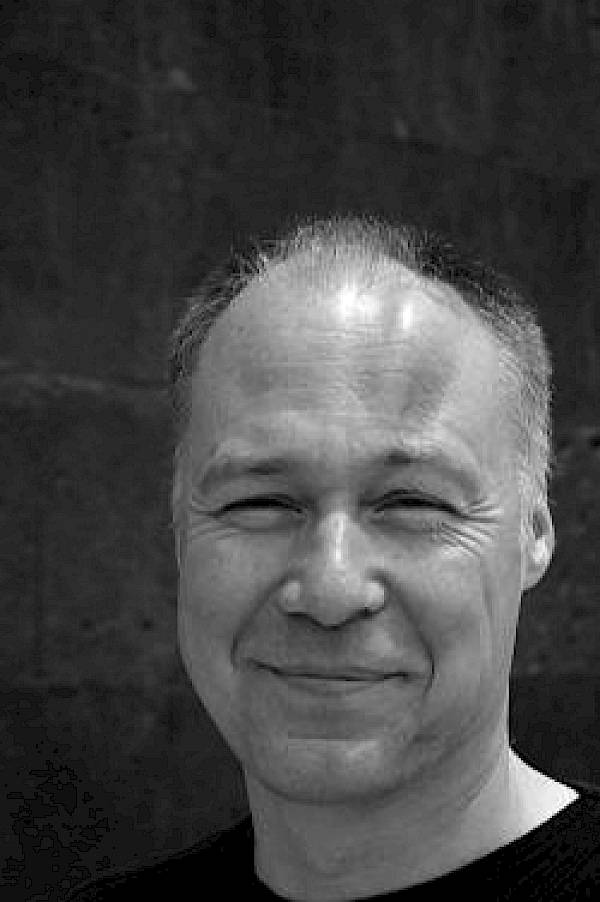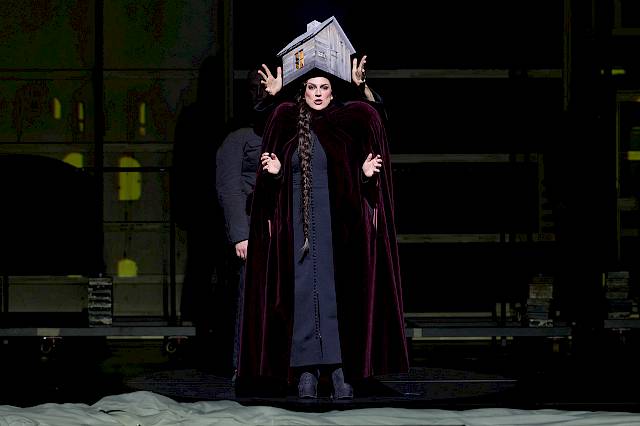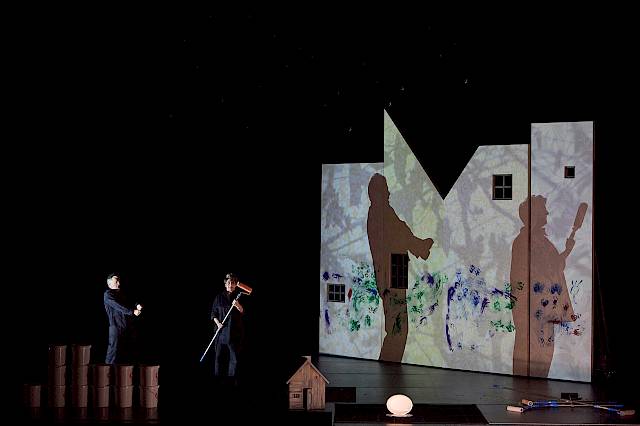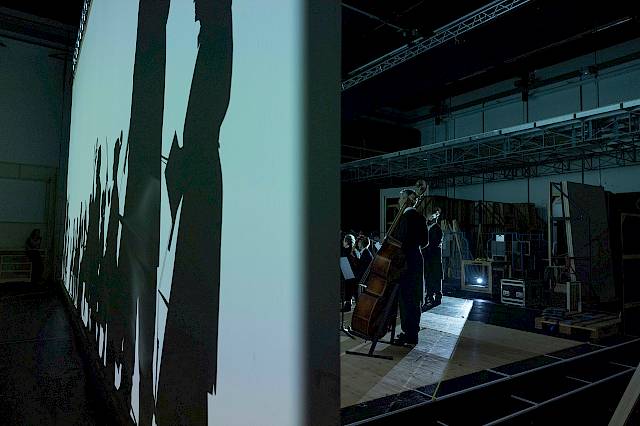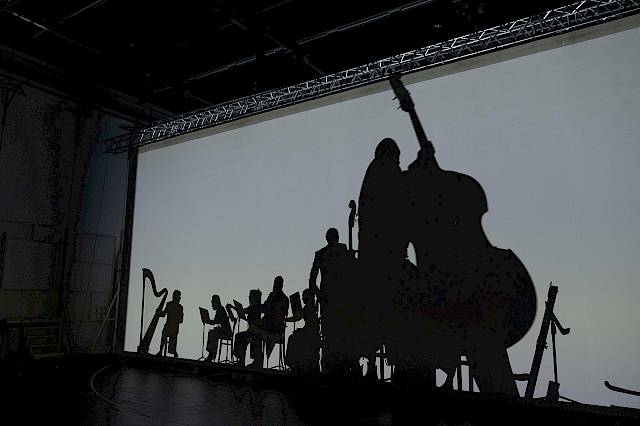«Hänsel und Gretel» gilt als Märchenoper par excellence. Hattest du eine besondere Verbindung zu diesem Werk in deiner Kindheit?
Eigentlich nicht. Ich bin in Litauen aufgewachsen, und dort gehören «Hänsel und Gretel» oder «Die Zauberflöte» nicht automatisch zum Kulturerbe, wie das im deutschsprachigen Raum der Fall ist. Ich glaube, ich habe die Oper als Kind gar nicht gesehen. Die Verbindung kam erst später, als ich in Österreich lebte und studierte – inzwischen bin ich seit siebzehn Jahren dort. Mein erster Kontakt mit «Hänsel und Gretel» war während meines Studiums an der Oper Leipzig, in einer verkürzten Fassung. Seitdem liebe ich das Stück. Es ist wunderbar komponiert und verbindet das Volksliedhafte, Kindliche und Märchenhafte mit einer hochromantischen, fein gearbeiteten Instrumentation. Für mich besteht gerade in der Verbindung dieser verschiedenen Ebenen der Reiz. Es ist nicht verwunderlich, dass es seit der Uraufführung ununterbrochen Erfolg hat. Kinder spricht es ebenso an wie Erwachsene. Ich werde nie müde von dieser Musik.
Die Oper hat eine eigenwillige Entstehungsgeschichte: Aus einigen Liedern und Texten von Adelheid Wette, Engelbert Humperdincks Schwester, entwickelte sich schliesslich eine durchkomponierte Opernform, die an Richard Wagner und Richard Strauss erinnert. Wie blickst du auf diese Form des Werkes?
Für mich ist die Form gar nicht so ungewöhnlich – es ist ein abendfüllendes Werk mit rund zwei Stunden Spieldauer, also eine richtige Oper. Ursprünglich war das ja gar nicht so geplant, aber Humperdinck hat erkannt, dass die Idee trägt. Besonders spannend finde ich die Instrumentation: Sie ist unglaublich einfallsreich, fast sinfonisch dicht. Genau darin liegt aber auch die Schwierigkeit – die Balance zwischen der kindlichen Welt und dem üppigen, kontrapunktischen Orchestersatz zu halten. «Hänsel und Gretel» ist in dieser Hinsicht eines der anspruchsvollsten Werke überhaupt.
Der Komponist Engelbert Humperdinck wurde oft als Wagner-Epigone bezeichnet. Wie siehst du das?
Natürlich hört man seine Bewunderung für Wagner, aber Humperdinck hat einen eigenen Ton. Schon das Libretto – ein Märchen! – führt ihn in eine völlig andere Richtung. Ich finde auch seine Oper «Königskinder» fantastisch, ein zu selten gespieltes Werk mit wunderschöner, tief berührender Musik. Sie steht auf meiner Wunschliste ganz oben.
Die Oper lebt stark vom Gegensatz zwischen dem Einfachen und dem Dramatischen. Wie empfindest du diesen Wechsel?
Ich finde, er ist Humperdinck hervorragend gelungen. Gleich in der Ouvertüre entfalten sich prachtvolle Orchesterfarben, und wenn der Vorhang sich erstmals hebt, erklingt das Volkslied «Suse, liebe Suse». Diese Einfachheit hat er mit grosser Ehrlichkeit beibehalten – das macht den Zauber aus. Auch das «Männlein im Walde» bleibt ganz schlicht, und gerade dadurch berührt es. Es ist erstaunlich, wie gut dieser Wechsel zwischen üppiger Romantik und volksliedhafter Naivität funktioniert.
In «Hänsel und Gretel» singen normalerweise erwachsene Sängerinnen Kinderrollen. Wie gehst du damit um?
Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Aber wir haben ein wunderbares Ensemble gefunden – Stimmen, die jugendlich klingen und trotzdem tragfähig sind. Wenn das Casting stimmt, entsteht diese Natürlichkeit ganz von selbst. Dann muss man nicht künstlich verstellen, sondern findet eine ehrliche stimmliche Balance.
In der Oper kippt die Stimmung oft – von heiterer Naivität in dunkle, fast furchtsame Welten. Wie spiegelt sich das in deiner musikalischen Arbeit wider?
Es geht eher darum, die verschiedenen Ebenen – Realität, Traum, Märchen – musikalisch durch Nuancen zu gestalten: durch Artikulation, Farbe, Dynamik. Die Musik selbst bleibt natürlich unverändert, aber man kann sie in ihrer Erzählung unterschiedlich beleuchten.
Die Oper beginnt und endet mit grossen musikalischen Bögen – was ist dir dabei besonders wichtig?
Mir gefällt Humperdincks Beschreibung der Hörner zu Beginn der Ouvertüre: Er nannte sie den «Schutzengel-Choral». Dieses Thema zieht sich durch die ganze Oper. Es vermittelt eine hoffnungsvolle Botschaft: Egal, wie schwierig die Situation ist – am Ende findet sich ein Licht. Das ist eine universelle Idee, ganz unabhängig von Religion. Und in einem Opernhaus, in dem wir oft tragische Schicksale erzählen, ist es schön, ein Werk zu haben, das mit Zuversicht endet.
Du bist zum dritten Mal am Opernhaus und dirigierst erstmals eine Premiere. Wie fühlt sich das an?
Ich freue mich riesig. Zürich ist für mich auch persönlich ein besonderer Ort – ich habe hier ein Austausch-Semester verbracht, viele Erinnerungen an meine Studienzeit und an Abende im Opernhaus. Damals hat mir Julie Fuchs oft eine Taxkarte überlassen – ich bin ihr bis heute dankbar! Ich habe dieses Haus immer geliebt: Es ist prachtvoll, aber dennoch intim. Diese Mischung, verbunden mit musikalischer Exzellenz, macht es einzigartig.
Wie erlebst du die Zusammenarbeit mit dem Orchester?
Sehr angenehm. Das Opernhaus Zürich ist ein unglaublich gut organisiertes Haus, mit positiver Atmosphäre und einem grossartigen Ensemblegeist. Ich habe hier als Assistentin gearbeitet und eine Wiederaufnahme dirigiert und leite hier nun meine eigene Premiere. Ich bin sehr glücklich, das hier zu erleben.